Vom guten und vom bösen ‚D-Wort‘
Vom guten und vom bösen ‚D-Wort‘
15.05.17
An digitalen Schlüsselkompetenzen für Lehrerinnen und Lehrer führt kein Weg vorbei, um den Unterricht an die Lebenswirklichkeit der Schüler anzupassen. Anja Penßler-Beyer von der Universität Potsdam erlebt, dass die Vermittlung im Lehramtsstudium für Hochschulen eine Herausforderung darstellt, auch weil die Lehrenden oft selbst keine didaktische Ausbildung haben.
Digitalisierung! – kaum ein Wort hat im Zusammenhang mit den Diskussionen zum Lernen und Lehren an Schulen und Universitäten in der Vergangenheit so viele hitzige Diskussionen hervorgerufen. Dabei wird das böse D-Wort in der Regel von denen verwendet, die Digitalisierung für eine temporäre Erscheinung halten, frei nach dem Motto: „Das geht schon wieder weg, wenn wir sie nur lange genug ignorieren“. Das gute D-Wort wiederum wird in der Regel von denen verwendet, die Digitalisierung als Teil einer Entwicklung verstehen, die es gilt, verantwortungsbewusst zu gestalten.
Neben einer fundierten fachwissenschaftlichen Qualifikation steht insbesondere die Vermittlung von methodischen Schlüsselkompetenzen im Zentrum eines jeden Studiums. Egal ob lehramtsbezogenen oder im reinen Fachstudium, ist es letztlich die Vermittlung genau dieser Grundkompetenzen, die dafür sorgt, dass der nahtlose Übergang zwischen theorielastigem Studium einerseits, und dem Einstieg in die reale Arbeitswelt andererseits, gelingt. Vor allem im Lehramtsstudium scheint es hier jedoch noch immer zu eklatanten Mängeln zu kommen. In meinem Gastbeitrag argumentiere ich, dass man auf die Digitalisierung setzen muss, um dieses Problem effektiv zu lösen.
Was in anderen Berufen kaum vorstellbar und auf dem freien Markt undenkbar ist, gehört im Lehramtsstudium zum Alltag: Laut Hochschulbildungsreport 2020 des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft denken lediglich 20 Prozent der Lehramtsstudierenden, dass ihr Studium die eigene Beschäftigungsfähigkeit fördert. Nur ein Fünftel der Lehrer von morgen traut sich also zu, nach Abschluss des Studiums alleine vor einer Schulklasse zu stehen. Diese Zahlen sind ein Hilferuf und angesprochen müssen sich hier diejenigen unter uns fühlen, die verantwortlich für die fachliche Ausbildung dieser jungen Menschen sind. Allen voran sind das die Hochschulen.
Internet als Freizeitbeschäftigung statt als Rechercheinstrument
![Fast alle Kinder und Jugendlichen haben Zugriff auf ein Smartphone. Bild: [https://unsplash.com/photos/FLdK5N-YGf4 Gaelle Marcel] Kind mit Smartphone](/sites/default/files/images/blog/gaelle-marcel-156147.jpg) Eine Prämisse pädagogischen Handelns besteht darin, dass Schülerinnen und Schüler dort abzuholen sind, wo sie stehen. Zudem soll guter Unterricht an der Lebenswirklichkeit der Schüler ausgerichtet sein. Schauen wir uns diese Lebenswirklichkeit doch einmal genauer an. Empirisch verifizierbare Daten liegen hier beispielsweise im Rahmen der seit 1998 angelegten JIM-Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbandes Südwest vor. Im Jahr 2016 haben demnach von den 1.200 befragten Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren insgesamt 99% Zugriff auf ein Smartphone; 98% haben zu Hause Zugriff auf einen Computer oder Laptop, und 97% haben Zugang zum Internet. Dem gegenüber steht die Tatsache, dass lediglich 41% der Schulen überhaupt über einen WLAN-Zugang verfügen, von denen allerdings lediglich 7% der Schülerschaft ein Datenbudget für Rechercheaufgaben bereitstellt. Nicht wenige Schulen verbieten demnach die Handynutzung auf dem Schulgelände sogar vollständig.
Eine Prämisse pädagogischen Handelns besteht darin, dass Schülerinnen und Schüler dort abzuholen sind, wo sie stehen. Zudem soll guter Unterricht an der Lebenswirklichkeit der Schüler ausgerichtet sein. Schauen wir uns diese Lebenswirklichkeit doch einmal genauer an. Empirisch verifizierbare Daten liegen hier beispielsweise im Rahmen der seit 1998 angelegten JIM-Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbandes Südwest vor. Im Jahr 2016 haben demnach von den 1.200 befragten Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren insgesamt 99% Zugriff auf ein Smartphone; 98% haben zu Hause Zugriff auf einen Computer oder Laptop, und 97% haben Zugang zum Internet. Dem gegenüber steht die Tatsache, dass lediglich 41% der Schulen überhaupt über einen WLAN-Zugang verfügen, von denen allerdings lediglich 7% der Schülerschaft ein Datenbudget für Rechercheaufgaben bereitstellt. Nicht wenige Schulen verbieten demnach die Handynutzung auf dem Schulgelände sogar vollständig.
Bei den jungen Erwachsenen liegen die Zahlen ähnlich hoch. Eine Studie der Universität Bonn zur Smartphone-Aktivität von rund 500 getesteten Personen zwischen 17 und 23 Jahren ergab eine durchschnittliche Nutzungszeit von täglich drei Stunden.
Halten wir also fest: Obwohl ab einem Alter von 12 Jahren nahezu 100% der Kinder und Jugendlichen sowohl über ein Smartphone, als auch über den nahezu uneingeschränkten Zugang zum Internet verfügt, ist es nur in knapp 7% der Schulen überhaupt möglich, in einem begrenzten Umfang schulische Recherchearbeiten durchzuführen. Im Umkehrschluss lernen damit rund 93% aller Schüler bis zum Abitur das Internet lediglich als Freizeitbeschäftigung kennen. Dies ist nicht nur eine unglaubliche Verschwendung wertvoller Onlineressourcen, es bringt uns in echte Erklärungsnot. Eine von der Europäischen Kommission groß angelegte Studie zur Internetnutzung an Schulen führte gar dazu, dass Deutschland in der Statistik gar nicht erst auftaucht, weil hier trotz aller Bemühungen sowie mehrmaliger Verlängerung der Abgabefristen und wiederholter intensiver Kontaktaufnahme mit den Kultusministerien der Länder die Mindestanzahl von 40 teilnehmenden Schulen unterschritten wurde. Das ist eine absolute Blamage und ein Schlag ins Gesicht der engagierten Schulen, die sich für eine kritische Auseinandersetzung zum Einsatz digitaler Medien an ihren Schulen öffnen möchten.
Ähnliche Anforderungen an Unterricht und Hochschullehre
Von den Schulen an die Universitäten kommend, treten Studierende dann heraus aus ihren antiquierten Klassenzimmern, um mit dem Eintritt in die Uni wiederum auf antiquierte Seminarräume und ein Jahrhunderte altes Hörsaaldesign zu treffen. Nach Abschluss ihres Studiums verlassen sie die Unis dann wieder in Richtung Schule, wo sie wiederum auf antiquierte… Sie wissen wie das weitergeht.
Vergleicht man die Anforderungen an Lehrerinnen und Lehrer an Schulen, mit denen der Lehrkräfte an Universitäten, fällt auf, dass sich die Anforderungen kaum voneinander unterscheiden.
| Lehre an Hochschulen | Lehre an Schulen |
|---|---|
| Unterricht gestalten | |
| Besuch von Fortbildungen | |
| Leistungsfähigkeit beurteilen | Leistungsfähigkeit diagnostizieren und beurteilen |
| Studentische Entwicklung möglichst individuell fördern | Schüler und ihre Entwicklung individuell fördern |
| Studentische Beratung | Schüler und Eltern beraten |
| Kollegialer Austausch | Austausch mit Kollegen und Eltern |
| Universitäre Selbstverwaltung | An Schulentwicklung mitwirken |
| Erziehungsaufgaben wahrnehmen | |
(Angelehnt an Tätigkeitsprofil der Ständigen Konferenz der Kultusminister, angelehnt an Bildungsreport 2020 des Stifterverbandes der Deutschen Wissenschaft)
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass wir, die wir die angehenden Lehrerinnen und Lehrer an den Universitäten unterrichten, in der Regel selbst keinerlei Ausbildung im Unterrichten erhalten haben. Im Gegensatz zu unseren Studierenden verstehen wir mit Beginn unserer Lehrtätigkeit in der Regel weder etwas von den psychologischen Grundlagen des Lernens, noch von methodischen Fragestellungen, geschweige denn können wir uns eigene didaktische Gestaltungsspielräume abstecken. Diejenigen unter uns, die ihre Lehre interessant gestalten wollen, bedienen sich notgedrungen an den positiven Erfahrungen des eigenen Studiums und versuchen, die negativen Beispiele zu vermeiden. Anreize, die eigene Lehre interessant zu gestalten, gibt es insbesondere für den Mittelbau kaum. Wer jedoch zur motivierten Gruppe gehört, der zuckt spätestens in seinem ersten Lehrsemester zusammen, wenn in seinem überfüllten Seminarraum um die 50 Studenten in sechs oder mehr unterschiedlichen Prüfungsordnungen studieren, und dementsprechend auch unterschiedliche Studien- und Prüfungsleistungen ablegen müssen.
Didaktik und digitale Medien für Lehrende
![Einsatz von digitalen Medien kann Routineaufgaben erleichtern. Bild: [https://unsplash.com/photos/mCg0ZgD7BgU Aleksi Tappura] Tisch mit Laptop](/sites/default/files/images/blog/aleksi-tappura-445.jpg) Erst in den letzten Jahren wurden an den Universitäten hochschuldidaktische Zertifikatsprogramme entwickelt. In mehrtägigen Workshops lernen Lehrende also nun auch endlich, wie man ein Seminar nach lernpsychologischen Standpunkten konzipiert und durchführt, oder dass die gewählte Unterrichtsform auch zur vorgeschriebenen Prüfungsform passen sollte. Weitergehende Veranstaltungen behandeln dann, häufig allerdings bisher auch nur stiefmütterlich am Rande, wie moderne Unterrichtsmethoden und der Einsatz von digitalen Medien die Lehrtätigkeit als solche sowohl für die Studierenden als auch für die Lehrenden angenehmer machen. Dabei liegt es auf der Hand, dass der sinnvolle Einsatz von digitalen Medien nicht nur eine Bereicherung für die eigene Lehre ist, sondern auch zeitaufwendige, wiederkehrende Aufgaben abnimmt, die sonst wertvolle Unterrichtszeit kosten. So können sich Lehrer untereinander schon seit einigen Jahren über Onlineplattformen gegenseitig ganz unkompliziert mit Unterrichtsmaterialien versorgen. Warum sollte dies nicht auch im Hochschulkontext funktionieren? Kollaborative Lerntools unterstützen die Arbeit in kleineren und größeren Teams. In digitalen Kurslisten behält der Lehrende den Überblick über eingereichte Worksheets und findet ohne großen Zeitaufwand heraus, welcher Student in welchen Bereichen noch mehr Input braucht. Es wäre die Studierendenzentriertheit par excellence. Die Liste könnte endlos weitergeführt werden. Leider gibt es immer noch zu wenige Fortbildungsangebote, die wiederum nicht verpflichtend, und vom Professorium zudem in der Regel eher selten besucht sind.
Erst in den letzten Jahren wurden an den Universitäten hochschuldidaktische Zertifikatsprogramme entwickelt. In mehrtägigen Workshops lernen Lehrende also nun auch endlich, wie man ein Seminar nach lernpsychologischen Standpunkten konzipiert und durchführt, oder dass die gewählte Unterrichtsform auch zur vorgeschriebenen Prüfungsform passen sollte. Weitergehende Veranstaltungen behandeln dann, häufig allerdings bisher auch nur stiefmütterlich am Rande, wie moderne Unterrichtsmethoden und der Einsatz von digitalen Medien die Lehrtätigkeit als solche sowohl für die Studierenden als auch für die Lehrenden angenehmer machen. Dabei liegt es auf der Hand, dass der sinnvolle Einsatz von digitalen Medien nicht nur eine Bereicherung für die eigene Lehre ist, sondern auch zeitaufwendige, wiederkehrende Aufgaben abnimmt, die sonst wertvolle Unterrichtszeit kosten. So können sich Lehrer untereinander schon seit einigen Jahren über Onlineplattformen gegenseitig ganz unkompliziert mit Unterrichtsmaterialien versorgen. Warum sollte dies nicht auch im Hochschulkontext funktionieren? Kollaborative Lerntools unterstützen die Arbeit in kleineren und größeren Teams. In digitalen Kurslisten behält der Lehrende den Überblick über eingereichte Worksheets und findet ohne großen Zeitaufwand heraus, welcher Student in welchen Bereichen noch mehr Input braucht. Es wäre die Studierendenzentriertheit par excellence. Die Liste könnte endlos weitergeführt werden. Leider gibt es immer noch zu wenige Fortbildungsangebote, die wiederum nicht verpflichtend, und vom Professorium zudem in der Regel eher selten besucht sind.
Aus der Politik ist bisher, bis auf einzelne Ausnahmen, kaum Unterstützung wahrzunehmen, ganz zu schweigen von einem erkennbaren Interesse, diesen Missstand zu reparieren. So ging die hessische Landesregierung, ganz im Sinne des postfaktischen Trends, solange auf die Suche nach einem Digitalisierungsgegner, bis sie ihn gefunden hat und endlich die Einsparkeule schwingen konnte, um über Jahre hinweg erfolgreich implementierte Digitalisierungsprojekte aus Kostengründen einzustellen.
Hochschullehrer als gutes Vorbild
Es liegt an der autonomen Gestaltungsfreiheit unserer Universitäten, dass wir diesem Trend ein Ende setzen. Durch konstruktive Disruption können wir es schaffen, einen Neuanfang zu wagen. Studierende müssen den professionellen und begleiteten Umgang mit digitalen Medien lernen, um nach Abschluss des Studiums als kompetente Wissensmanager in ihren Schulklassen auftreten zu können. Idealerweise dienen ihre Hochschullehrer dabei als gutes Vorbild. Solange aber die Lehrenden an den Hochschulen keine adäquate Lehrausbildung erhalten – und kommen Sie mir jetzt bitte nicht mit der venia legendi – können wir auch unseren Studierenden nicht beibringen, wie sie den verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Medien weitergeben können.
Die Herausforderung der Hochschulen muss demnach in der Vermittlung digitaler Schlüsselkompetenzen im Lehramtsstudium liegen. Schulformenübergreifend gilt es, den verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Medien einerseits, sowie die kompetente und vor allem sinnvolle Integration von digitalen Medien in den Unterricht andererseits, curricular in den Studien- und Prüfungsordnungen zu verankern – und zwar deutschlandweit, für alle Lehramtsstudiengänge.
Acht von zehn Lehramtsstudierenden fühlen sich von ihrer Universität schlecht auf ihren Einstieg ins Berufsleben vorbereitet. Hochschullehrende sind in der Regel nicht oder nur unzureichend für die Lehrtätigkeit ausgebildet worden – eine Überprüfung der Lehrkompetenz findet kaum statt. Wir müssen es schaffen, endlich mit gutem Beispiel voran zu gehen. Dann gelingt es auch, dass in der Zukunft immer mehr Lehrende das Wort Digitalisierung für ein gutes D-Wort halten.


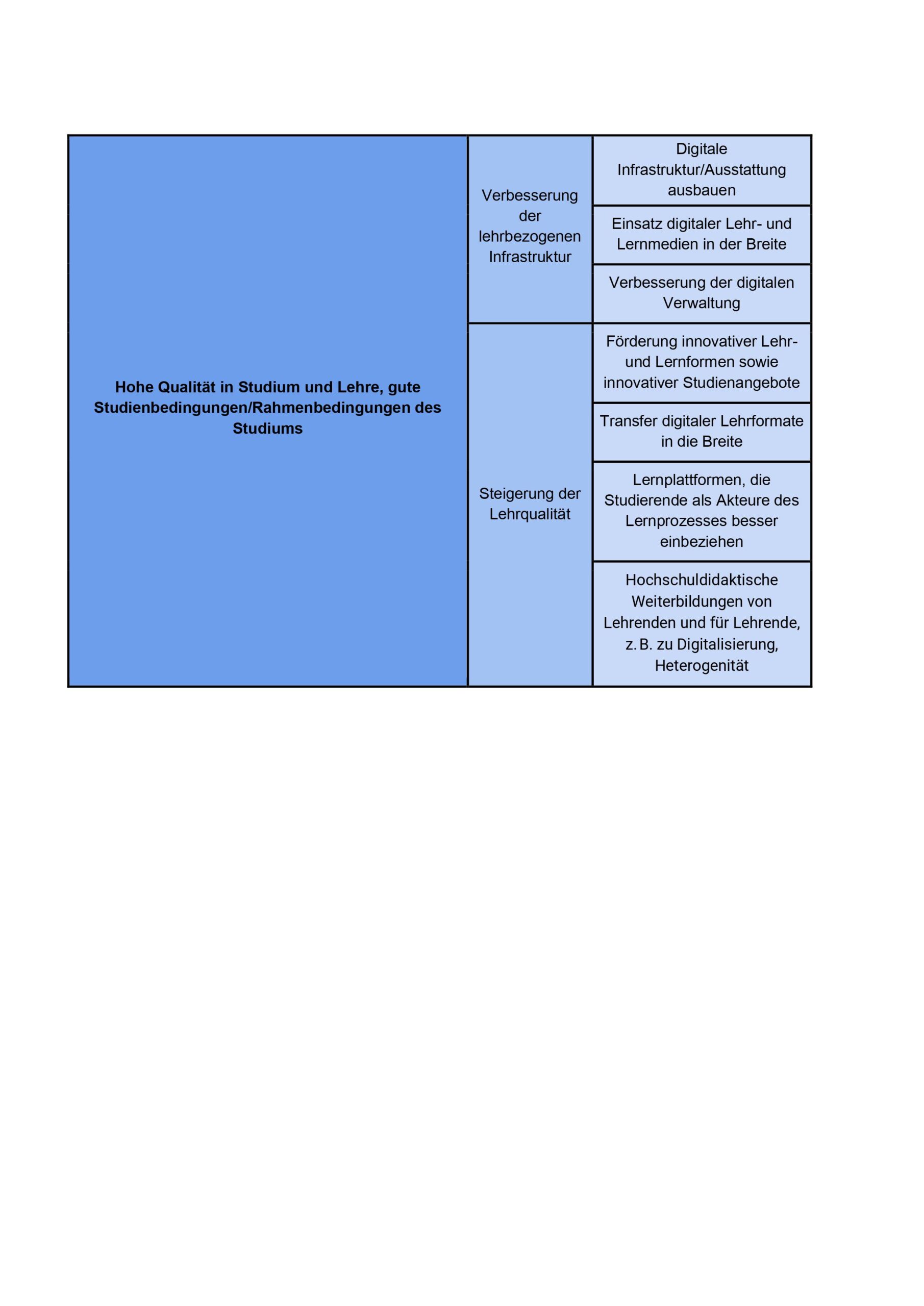
 Lukas Brand
Lukas Brand 
 Reinhard Karger, M.A.
Reinhard Karger, M.A. 