Ausgezeichnet im Essaywettbewerb: Mehr Wahrhaftigkeit!
Ausgezeichnet im Essaywettbewerb: Mehr Wahrhaftigkeit!
05.05.15Warum Bildung für die junge Generation kein Fetisch ist
Brauchen wir ein Bildungsideal? In der Alltagssprache werden „Bildung“ und „Ausbildung“ oft gleichgesetzt; doch blickt man auf die Ideengeschichte des Bildungsbegriffes zurück, dann wird klar, dass mit diesem Begriff noch etwas anderes gemeint sein muss als der bloße Erwerb von Faktenwissen: Bildung zielt auf die Formung der Persönlichkeit. Bedenkt man indes, dass es hierzulande der Staat ist, der viele der Einrichtungen betreibt und lenkt, in denen sich Bildung vollziehen könnte, dann ist es alles andere als klar, weshalb eine liberale, pluralistische Gesellschaft überhaupt auf das Konzept eines Bildungsideals zurückgreifen sollte. Der Staat nicht nur als Organisator der Berufsausbildung, sondern als eine Art oberster Wertevermittler – wollen wir das überhaupt? Die eine Möglichkeit wäre, kritisch darauf hinzuweisen, dass der Versuch, Menschen mit von oben verordneten Idealen zu überformen, in einer wertepluralen Gesellschaft zum Scheitern verdammt sein muss. Ich möchte die Gegenposition vertreten, weil ich glaube, dass es in der Tat erstrebenswert ist, einen Kanon universeller Grundwerte zum Gegenstand eines Bildungsideals zu erheben. Ein Beispiel hierfür könnte das Prinzip verantwortlichen Handelns sein: Egal, was du aus welchen Überzeugungen heraus tust, bedenke die Folgen deiner Handlungen und stelle dich der Verantwortung, die dir aus ihnen erwächst.
Wie uns die Wissenschaft zur Objektivität erzieht
Wie werden solche Werte vermittelt? Ich möchte versuchen, mit Blick auf die wissenschaftlichen Hochschulen eine Antwort zu skizzieren. Meine These lautet: Wenn wir wollen, dass junge Menschen zu verantwortungsvollen Bürgern heranwachsen, müssen wir ihnen eine Form von Souveränität an die Hand geben, die vom Geist der Unbestechlichkeit beseelt ist. Die wissenschaftliche Bildung kann hier einen bemerkenswerten Beitrag leisten. Dort, wo junge Leute – als Studenten, Doktoranden, Nachwuchsforscher – mit der wissenschaftlichen Arbeitsweise konfrontiert werden, können sie lernen, was es heißt, nach Objektivität zu streben; damit geht ein Bildungseffekt einher, weil die erlernte Haltung intellektueller Redlichkeit das Handeln auch in außerwissenschaftlichen Kontexten prägt.
Einer tradierten, wenn auch gewiss nicht mehr auf alle Wissenschaftssparten zutreffenden Vorstellung gemäß lässt sich das Betreiben von Wissenschaft als neugieriges und aufrichtig-demütiges Streben nach Wahrheit charakterisieren. Dem wissenschaftlichen Ethos ist die Pflicht einbeschrieben, Hypothesen gründlich zu prüfen, das Prinzip der wechselseitigen sachlichen Kritik hochzuhalten und keine Hierarchien zuzulassen außer jene temporären, die sich aus der Kraft des besseren Arguments ergeben. Ernsthaftes Erkenntnisstreben im Geiste Francis Bacons, des Urvaters der modernen Wissenschaft, richtet alles danach aus, relevante Erkenntnisse zu erzeugen. Wer sich diesem Postulat unterwirft, ist weder selbstgenügsamer Glasperlenspieler noch Bildungsblender. Er ist ein Diener der Wahrhaftigkeit.
Diese ist eine wichtige Tugend, derer nicht nur diejenigen bedürfen, die Wissenschaftler werden wollen. Sie hilft uns im Alltag, schwierige Entscheidungen zu treffen, geht uns zur Hand, wenn es gilt, die mediale Informationsflut einzuordnen. Mehr noch: Wer ein aufrichtiges Interesse an der Wahrheit hat, der entlarvt Ideologien und ächtet politisch motivierte Sprachvergewaltigungen. Der setzt sich für Meinungsfreiheit ein, weil er verstanden hat, dass diese nicht nur eine Einrichtung ist, die sich liberale Gesellschaften gleichsam als Luxus leisten, weil keinem gern der Mund verboten wird, sondern dass die Möglichkeit, dass Meinungen geäußert werden können, die wichtigste Grundbedingung für jeden Meinungsbildungsprozess ist. Der widerspricht, auch wenn er mit seiner Meinung allein steht. So jemand wäre vielleicht nicht zwingend ein „besserer Mensch“ in einem allumfassenden Sinne, aber er würde gewiss unsere Gesellschaft bereichern.
Was die Digitalisierung damit zu tun hat
Spannend wird die Angelegenheit, wenn wir uns fragen, wie die digitalen Technologien sich in dieses Bild fügen könnten. Gewiss: Die Mittel, derer man sich heute bedient, sind besser, effizienter geworden – um Welten. Aber was heißt das inhaltlich für den Bildungsbegriff? Die Debatte um die Bedeutung der Digitalisierung für die Bildung ist bislang fast ausschließlich aus der Perspektive der Technik geführt worden. Wir deklarieren massive open online courses, kurz: MOOCs, zu Wegbereitern einer neuen Form akademischer Lehre. Wir beginnen, Twitter und andere Apps und Widgets zu nutzen, um bei Lehrveranstaltungen von den Studenten ein direktes Feedback zu erhalten. Wir recherchieren in digitalen Datenbanken und auf Google Scholar, anstatt in staubigen Zettelkästen zu stöbern und Regale zu durchforsten. Doch sind das wirkliche Revolutionen?
Ein MOOC ist eine großartige Sache, aber nur die Erweiterung des Prinzips „Lehrveranstaltung“. Elektronisches Feedback mag hilfreich sein, dient aber lediglich dazu, etwas herzustellen, was selbstverständlich sein sollte: dass die Studenten mit dem Dozenten interagieren. Und Datenbanken sind nichts anderes als große, ohne Aufwand durchsuchbare Bibliotheken. Vieles geht heute schneller – geschenkt. Abseits der Machbarkeitseuphorie wird ein Gesichtspunkt übersehen, der eine viel substanziellere Veränderung bedeuten könnte: dass die digitale Revolution ihre Kinder zu einer unkomplizierten, verständlichen Sprache erzieht – und damit zu klarerem Denken. Die Generation Smartphone ist es gewohnt, dass ihr Inhalte knackig präsentiert werden. Eine Spiegel-Online-Geschichte kommt schneller zum Punkt als eine Geschichte im gedruckten Spiegel. Der Kurznachrichtendienst Twitter honoriert denjenigen mit Anhängerschaft, dem es gelingt, Gedanken auf einer Länge von nicht mehr als 140 Zeichen zu verdichten. Die Lakonie der Instant-Messaging-Dienste prägt die alltägliche Kommunikation ungleich stärker, als ausladend formulierte Briefe es tun.
Es ist wichtig, zu betonen, dass es sich dabei – auch – um segensreiche Entwicklungen handelt. Zumal gerade das wissenschaftliche Establishment dazu neigt, sie kritisch zu beäugen. Ich würde dagegenhalten: Wenn die Ungeduld des wissenschaftlichen Nachwuchses dazu führt, dass sich die Kultur der akademischen Kommunikation hin zur Verständlichkeit ändert, dann werden insgesamt mehr Inhalte vermittelt. Nimm eine Banalität, tauche sie in Zitate und verklausuliere sie so lange mit professoralem Duktus, bis sie klug und belesen klingt: Das ist oft das Rezept der Wahl zur Herstellung akademischer Texte. Das soll und wird sich ändern. Nicht jeder Sachverhalt wird durch scholastische Abhandlungen mit undurchschaubaren Nebensatzverschachtelungen (oder, noch schlimmer: durch den mündlichen Vortrag eben dieser) am adäquatesten zum Ausdruck gebracht. Die jungen Leute sind sensibel für diese Problematik, und das ist eine gute Nachricht. Pointiert formuliert: Derjenige, der schreiben kann wie Adorno, mag sprachkompetent sein. Aber derjenige, der weiß, wann er besser darauf verzichtet, ist sprachkompetenter.
Eine Frage der Generationen
Ich erinnere mich daran, wie ein Professor aus den Gesellschaftswissenschaften, ein älterer Herr mit weißen Haaren, einmal sichtlich stolz über seine Studienzeit in den frühen Siebzigerjahren sprach: Am Seminarraum habe vor Semesterbeginn eine Liste mit Büchern gehangen, „um die fünfzig“. Wer die nicht gelesen hatte, habe erst gar nicht zu kommen brauchen. Er wirkte stolz, aber das Gros seiner jungen Zuhörerschaft schien nicht sonderlich beeindruckt zu sein. Für uns Jüngere sind solche Anekdoten eher befremdlich. Weil wir wissen, dass niemand ernsthaft 50 Bücher für ein einziges Seminar lesen kann. Weil wir ahnen, dass es auch gar nicht zielführend wäre, schließlich käme man dabei gar nicht mehr zum Denken. Vor allem aber, weil bei dem Verweis auf die schiere Quantität an Gelesenem ein seltsamer Fetisch für das Bücherlesen als Tätigkeit und Selbstzweck durchscheint, der uns unheimlich ist.
Es ist vielfach betont worden, dass sich die Generation Y, beständig von prekären Lebensverhältnissen bedroht, dem Pragmatismus zugewandt hat. Dazu passt, dass sie kein Jünger einer Bildungsreligion sein will, wie sie vorhergehende Generationen in vermeintlich besseren Zeiten auf den Altar gehoben haben, damals, als es üblich war, an drei Universitäten fünf Fächer in 15 Semestern zu studieren. Wenn wir an den Suhrkamp Verlag oder das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung denken, läuft den wenigsten von uns noch ein wohliger Schauer über den Rücken. Wir wollen etwas lernen und unseren Horizont erweitern, durchaus, und wir bohren gerne dicke Bretter, wenn es sein muss – aber nicht um des Bohrens willen. Dazu sind wir zu sehr an der Effizienz orientiert. Deshalb haben wir auch kein Verständnis dafür, dass uns der Weihrauch prätentiöser Wortkaskaden die Sicht auf die Tatsachen vernebelt.
Verständlichkeit und sprachliche Klarheit sind wesentliche Voraussetzungen für eine Haltung der intellektuellen Redlichkeit. Oben habe ich angedeutet, dass diese Haltung einen Wert für den akademischen Nachwuchs haben könnte, der über das rein Wissenschaftliche hinausweist – man könnte in ihnen Bestandteile eines erneuerten Bildungsideals sehen. Doch nicht nur die Jungen können von den Alten lernen: Wenn die Studenten den Anspruch in die Lehrveranstaltungen hineintragen, präzise und verständlich informiert werden zu wollen, wenn Jungwissenschaftler ihre Seminare mit eben diesem Anspruch durchführen, dann könnte eine bemerkenswerte Situation entstehen. So mancher alteingesessene Professor könnte dann nämlich von der Jugend daran erinnert werden, dass sich wissenschaftliche Exzellenz in Lehre und auch bei der Publikation von Forschungsergebnissen nicht daran bemisst, durch wie viele gelehrte Exkurse sich Sachinformationen ausdünnen lassen. Die digitale Revolution hätte dann zu einem Kulturwandel geführt, von dem alle Beteiligten profitieren.


 Prof. Aloys Krieg
Prof. Aloys Krieg 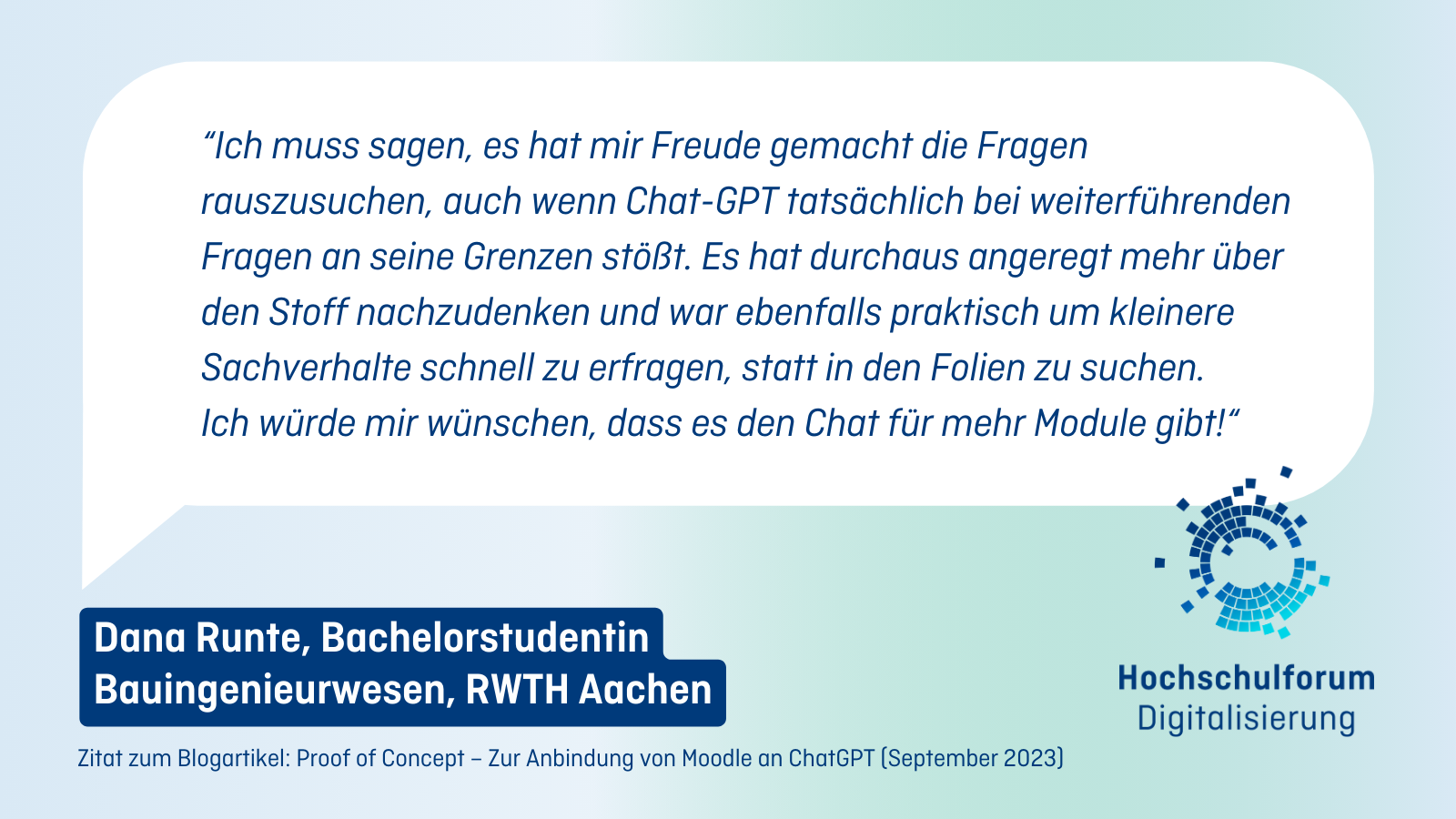
 René Rahrt
René Rahrt 