Hochschulstrategie: Angriff ist die beste Verteidigung
Hochschulstrategie: Angriff ist die beste Verteidigung
20.10.15
Ralph Müller-Eiselt ist zusammen mit Jörg Dräger Autor des gerade erschienenen Buches „Die Digitale Bildungsrevolution„. Dieser Blogbeitrag ist ein stark gekürzter Auszug aus dem Kapitel „Kein Stein bleibt auf dem anderen“, in dem er über Hochschulstrategien vor dem Hintergrund der Digitalisierung schreibt.
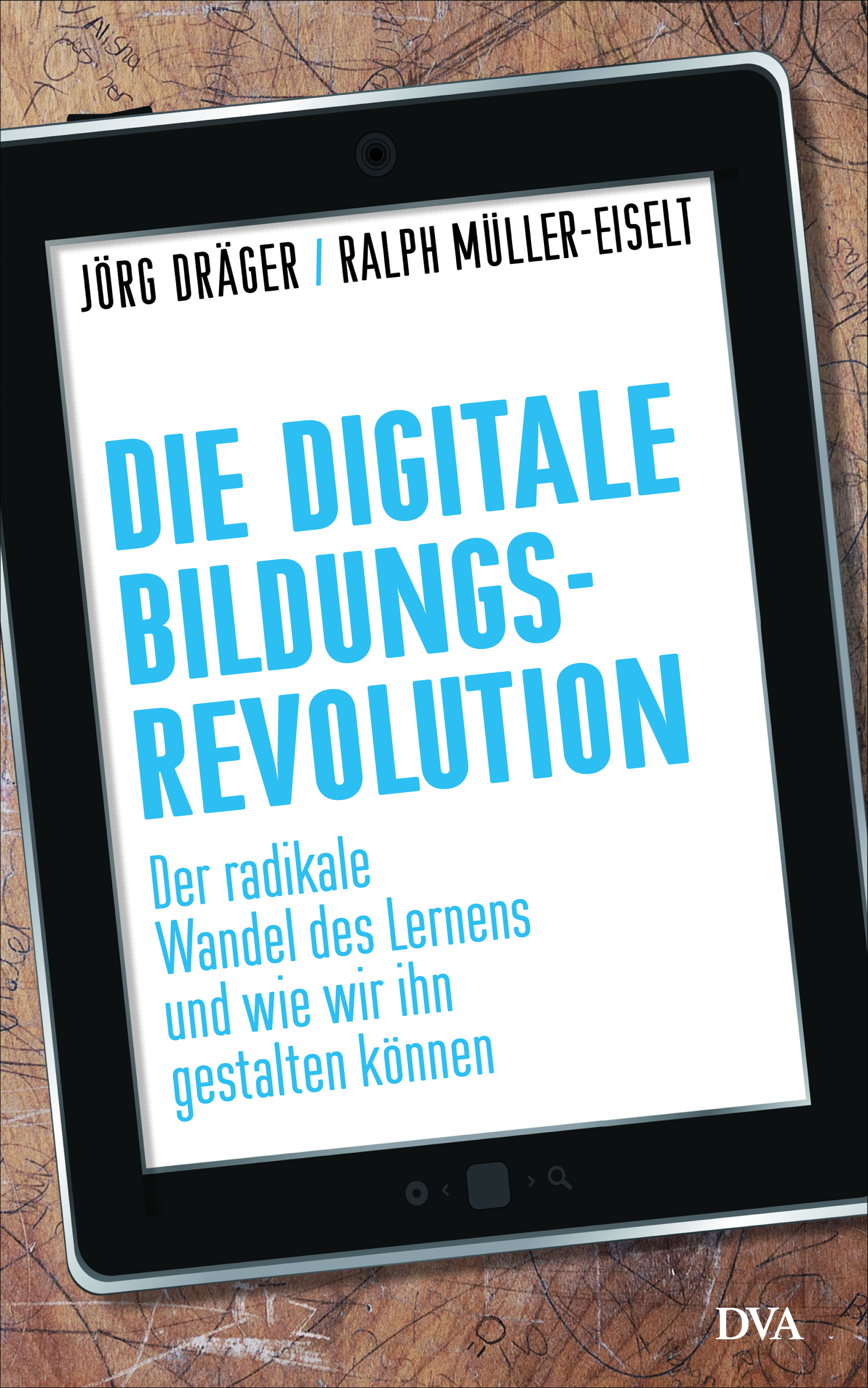 Namhafte Experten sagen dem Hochschulsystem in seiner heutigen Form ein baldiges Ende voraus. »In 15 Jahren wird mehr als die Hälfte der amerikanischen Hochschulen bankrott sein«, prognostiziert etwa der Harvard-Professor Clayton Christensen. Die Digitalisierung lässt heute schon Institutionen neuen Typs entstehen, die ohne Technologie niemals möglich gewesen wären. Die private Hochschule Minerva etwa baut ihr Geschäftsmodell auf einer nach neuesten didaktischen Erkenntnissen entwickelten Onlineplattform auf, über die das gesamte Studium organisiert wird. Im Vordergrund steht die Lehre via Internet – und interkulturelles Lernen vor Ort. Man verzichtet auf teure Hochschulbauten, unterhält stattdessen Studentenwohnheime in den Metropolen der Welt, neben San Francisco oder Buenos Aires bald auch in Berlin. Wer bei Minerva studiert, lernt in vier Jahren vier Städte, Kulturen und Sprachen kennen, während die Online-Lerngruppe, unterrichtet von fachlichen Koryphäen, konstant bleibt. Dieser Fokus aufs Wesentliche, auf Unterricht und Betreuung, ist auch ökonomisch interessant: Minerva verspricht seinen Studierenden Lehre auf internationalem Spitzenniveau, verlangt aber nur etwa die Hälfte der an Eliteuniversitäten üblichen Studiengebühren.
Namhafte Experten sagen dem Hochschulsystem in seiner heutigen Form ein baldiges Ende voraus. »In 15 Jahren wird mehr als die Hälfte der amerikanischen Hochschulen bankrott sein«, prognostiziert etwa der Harvard-Professor Clayton Christensen. Die Digitalisierung lässt heute schon Institutionen neuen Typs entstehen, die ohne Technologie niemals möglich gewesen wären. Die private Hochschule Minerva etwa baut ihr Geschäftsmodell auf einer nach neuesten didaktischen Erkenntnissen entwickelten Onlineplattform auf, über die das gesamte Studium organisiert wird. Im Vordergrund steht die Lehre via Internet – und interkulturelles Lernen vor Ort. Man verzichtet auf teure Hochschulbauten, unterhält stattdessen Studentenwohnheime in den Metropolen der Welt, neben San Francisco oder Buenos Aires bald auch in Berlin. Wer bei Minerva studiert, lernt in vier Jahren vier Städte, Kulturen und Sprachen kennen, während die Online-Lerngruppe, unterrichtet von fachlichen Koryphäen, konstant bleibt. Dieser Fokus aufs Wesentliche, auf Unterricht und Betreuung, ist auch ökonomisch interessant: Minerva verspricht seinen Studierenden Lehre auf internationalem Spitzenniveau, verlangt aber nur etwa die Hälfte der an Eliteuniversitäten üblichen Studiengebühren.
Ein anderes, dank Digitalisierung mögliches Extrembeispiel wäre eine »Anerkennungshochschule«. Sie würde sich darauf spezialisieren, Vorkenntnisse in Kreditpunkte zu verwandeln und mittels eines Online-Kompetenztests ein persönliches Portfolio an Vorlesungen und Seminaren zu identifizieren, das für einen gewünschten Abschluss noch fehlt. Die notwendigen Kurse, um diese Lücke zu schließen, können als MOOCs meist auch aus der Ferne absolviert werden. Solche Hochschulen brauchen keine eigenen Professoren. Wie ein Makler vermitteln sie lediglich Bildungsinhalte und zertifizieren auf sehr individueller Ebene, dass das Können und Wissen einer bestimmten Person einem Hochschulabschluss gleichwertig ist. Im Extremfall müssen Studierende dazu, wie etwa an der amerikanischen Western Governors University, nicht ein einziges Mal einen Hörsaal betreten.
If you can’t beat them, join them
Nicht jeder kann und muss sich vollkommen neu erfinden. Aber auch die bereits bestehenden Hochschulen, die sich nicht als Nischenangebot verstehen oder die gut situierte Elite adressieren, sollten dringend Strategien entwickeln, wie sie die unausweichliche Digitalisierung in ihr System integrieren. Für sie gilt: Angriff ist die beste Verteidigung. Getreu dem Motto »If you can’t beat them, join them« hat sich beispielsweise die Arizona State University, mit knapp 70 000 Studierenden vor Ort die größte Campus-Hochschule der USA, auch auf den Weg ins digitale Massengeschäft gemacht. Im Rahmen ihrer »Global Freshman Academy« kann künftig jeder überall auf der Welt kostenfrei das erste Collegejahr komplett online absolvieren. Es gibt keine Aufnahmetests oder Zugangsbeschränkungen, über die endgültige Zulassung entscheidet nur die Leistung während dieses Jahres. Das Risiko für Studierende ist überschaubar; erst nach bestandener Prüfung fallen Gebühren an – und die sind mit weniger als 6000 US-Dollar für das erste Studienjahr moderat. Zum Vergleich: Das Präsenzstudium inklusive Unterkunft auf dem Campus kostet mehr als das Sechsfache. Die Onlinekurse sind vollständig auf das restliche reguläre Studium anrechenbar. Einen Kannibalisierungseffekt fürchtet man in Arizona nicht. Im Gegenteil: Vom digitalen Einstiegsjahr für jedermann verspricht sich die Hochschule positives Marketing und die Gewinnung neuer Studierender vor allem aus dem Ausland.
Auch die renommierte EPF Lausanne, die französischsprachige und nicht minder elitäre Schwester der Züricher Bundesuniversität ETH, hat MOOCs zu einem strategischen Ziel erklärt. Die Schweizer Hochschule will damit nicht nur ihre internationale Sichtbarkeit steigern, sie verspricht sich auch positive Wirkungen für die Qualität der Lehre auf dem eigenen Campus. Wenn dort die Einführungsvorlesung parallel von mehreren Professoren angeboten wird, sind der Abstimmung mit den Füßen durch die Größe der Hörsäle Grenzen gesetzt. Onlinekurse hingegen machen transparent, bei wem am liebsten – und deshalb oft auch am besten – gelernt wird. Zudem strengen sich die Professoren in ihrer Onlinevorlesung wohl noch mehr an, als sie es im Hörsaal tun, wenn nicht nur Studierende, sondern auch die eigenen Kollegen zuschauen können.
The winner takes it all?
Auch wenn in Deutschland aufgrund des staatlich finanzierten Hochschulsystems die amerikanischen Bankrott-Prognosen ins Leere laufen: Eine Digitalisierungsstrategie ist auch hierzulande essenziell für Hochschulen, damit sie sich bei immer mehr und immer vielfältigeren Studierenden auf Dauer behaupten können. Nicht jede Universität oder Fachhochschule muss sich vollständig digitalisieren, nicht jede selbst Onlinekurse produzieren, aber alle sollten sich über die eigenen strategischen Ziele klar sein und ihre Angebote entsprechend ausrichten. Noch haben laut einer aktuellen Umfrage vier von zehn deutschen Hochschulen keine solche Entscheidung getroffen.
Digitale Märkte neigen zu Monopolen, auch in der Onlinelehre gilt das »The winner takes it all«-Prinzip. Produzenten von MOOCs und Lernvideos etwa werden meist über eine starke Marke verfügen und diese nutzen, um ihre Expertise weltweit bekannt zu machen. Stanford, das MIT und Harvard sind hier die Vorreiter. Nicht alles muss aber aus den USA kommen. Auch die TU9, die neun führenden technischen Universitäten in Deutschland, könnten beispielsweise ein Ingenieurstudium »made in Germany« global positionieren. Die Digitalisierung macht starke Marken stärker, lässt aber auch kleine spezialisierte Nischenanbieter groß werden: So könnte es der Bucerius Law School in Hamburg über Onlineangebote durchaus gelingen, den deutschen Standard für die Lehre in den Rechtswissenschaften zu prägen; ebenso weltweit der Universität Marburg in der Keltologie oder der TUM Weihenstephan im Bierbrauen. Dies würde nicht zuletzt auch dazu beitragen, sogenannte Orchideenfächer am Leben zu halten.
Bologna Digital
Die meisten Hochschulen werden in Zukunft verstärkt von anderen produzierte Inhalte nutzen und sich selbst mehr auf die Begleitung der Studierenden konzentrieren. Kleinere Fachhochschulen von der Nordseeküste bis zum Bodensee können sich so zusätzliche Vertiefungen leisten und dank gesparter Vorlesung mit besserer individueller Betreuung punkten. Möglicherweise werden sie sogar in einer Art Franchise-Modell den Abschluss einer anderen, markenstärkeren Hochschule vergeben: im Harz studiert, aber das Diplom aus Aachen oder Wien in der Tasche. Gerade der Bologna-Prozess bietet hier eine große Chance. Einst geschaffen, um die Mobilität der Studierenden innerhalb Europas zu befördern, ermöglicht dieser nun die Mobilität der Bildung selbst. Das Kreditpunktesystem erlaubt den Vergleich und die gegenseitige Anerkennung von Lernleistungen in ganz Europa. Damit ist, anders als in den USA, die größte Hürde für die systematische Anrechnung von Onlinebildung auf reguläre Studiengänge bereits genommen. »Bologna Digital« kann aus dieser ungeliebten Reform doch noch eine Erfolgsgeschichte machen.
Clayton Christensens eigene Universität dürfte von seinem eingangs zitierten Untergangsszenario übrigens kaum gefährdet sein. Spitzenhochschulen wie Stanford, Harvard oder auch die ETH Zürich mögen digitale Angebote als attraktiven Zusatz beurteilen, können es sich aber leisten, im Kern zu bleiben, wie sie heute sind. Eine elitäre Campus-Uni, die sich wie Oxford explizit gegen digitale Komponenten, aber für eine sehr persönliche Betreuung und kleine Lerngruppen vor Ort entscheidet, wird auch künftig ihre Berechtigung und Nachfrage haben – als exklusives Lernerlebnis für wenige Auserwählte. In Deutschland finden sich solche Beispiele in kleinen, feinen Nischen. Das anthroposophische Studienmodell der privaten Uni Witten/Herdecke, die Hochschulen für Kirchenmusik oder einige der Kunsthochschulen könnten, solange es die Finanzierung erlaubt, auch in Zukunft alleinig auf den analogen Austausch auf dem Campus setzen. Für alle anderen gilt: Man mag die Digitalisierung gut finden oder nicht – einen Stopp-Knopf, mit dem sie sich aufhalten lässt, gibt es nicht. Auch deutsche Hochschulen werden sich ihr auf Dauer nicht entziehen können.
Jörg Dräger im Interview

